Aktuelle Social Media Debatten
Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie meinen Newsletter
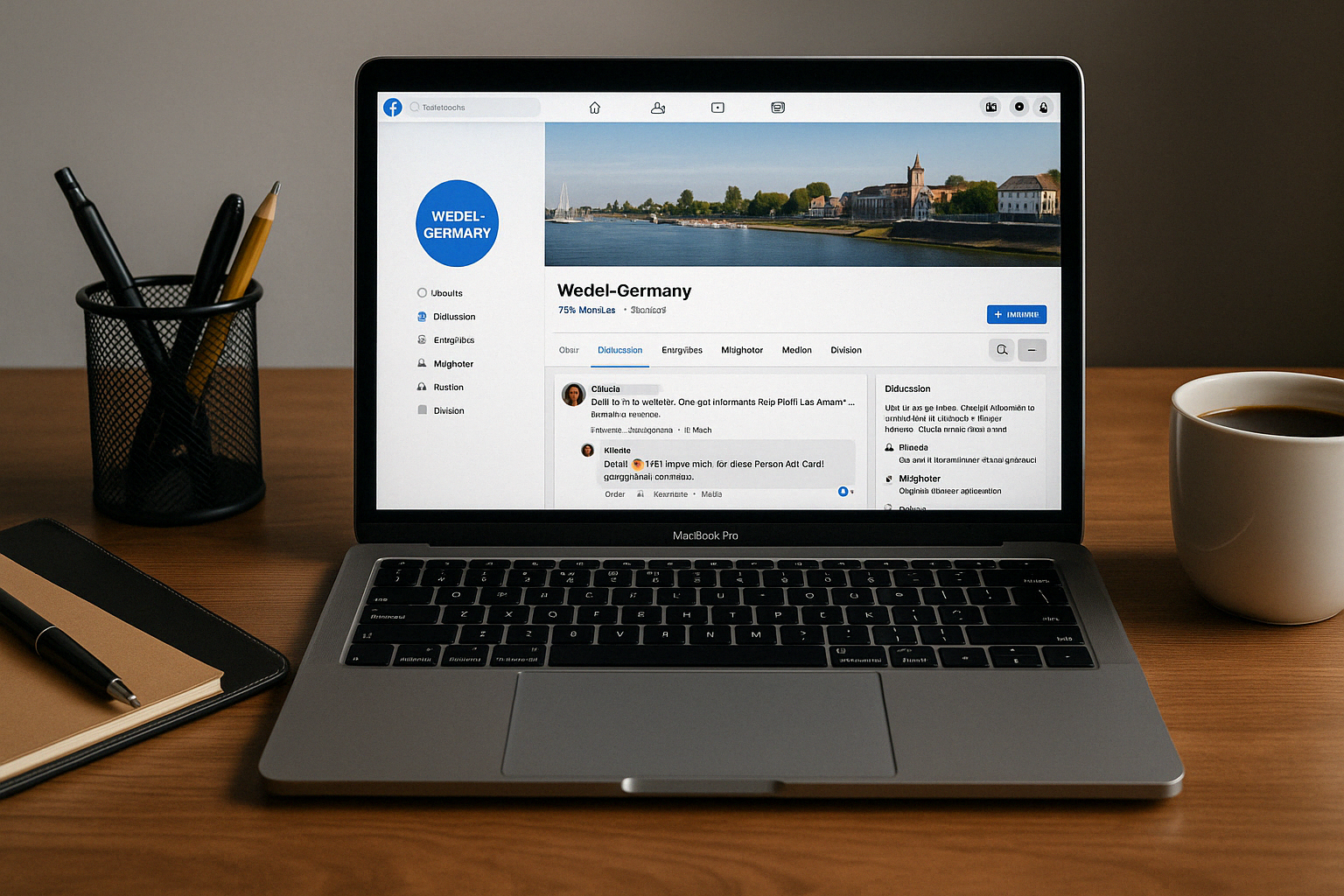
Warum ich über Wedels Social Media-Debatten schreibe
Ich schreibe über das, was in Wedel diskutiert wird – nicht, weil es bequem ist, sondern weil ich überzeugt bin, dass Öffentlichkeit, Transparenz und Einordnung wichtig sind. Gerade in Zeiten, in denen Diskussionen im Netz oft schnell hitzig oder unfair werden, braucht es Räume für Reflexion.
Diese Rubrik ist aus der Erfahrung heraus entstanden, wie sehr sich die digitale Debattenkultur in Wedel verändert hat – und nicht immer zum Guten. Ich habe über Jahre aktiv an Diskussionen in lokalen Facebookgruppen teilgenommen, mich der Kritik gestellt, den Austausch gesucht. Doch irgendwann musste ich feststellen: Was als Diskussionsplattform gedacht war, wurde zunehmend zu einem Ort für persönliche Angriffe, Unterstellungen und Desinformation.
Ein sachlicher Austausch war kaum noch möglich. Statt Argumenten gab es Diffamierungen. Statt Auseinandersetzung mit Inhalten – pauschale Vorwürfe, etwa meine politische Webseite würde „Propaganda“ betreiben oder gezielt Verwirrung über ihre Unabhängigkeit stiften. Solche Behauptungen halten keiner Überprüfung stand, doch sie zeigen, wie schwer es geworden ist, in digitalen Räumen konstruktiv zu streiten.
Trotzdem glaube ich: Was in sozialen Medien passiert, verdient Aufmerksamkeit – gerade auf lokaler Ebene. Denn auch hier bei uns in Wedel spiegeln sich dort gesellschaftliche Stimmungen, Konflikte und Entwicklungen, die uns alle betreffen.
Mit dieser Rubrik möchte ich einen Beitrag leisten. Ich greife Themen auf, die online in Wedel diskutiert werden, analysiere, ordne ein – und lasse Raum für Perspektiven. Dabei bleibe ich bei meinem Anspruch: faktenbasiert, transparent, klar in der Haltung, offen für Kritik.
Ich mache das allein, mit viel Engagement und dem Wunsch, Debatten wieder zugänglicher, verständlicher und konstruktiver zu machen. Wer sich sachlich informieren, hinterfragen oder mitdenken möchte, ist herzlich eingeladen, mitzulesen.
– Jan Lüchau
Starke Worte, schwache Belege
Kloevekorns Post arbeitet mit markigen Begriffen und BVerwG-Aktenzeichen, aber ohne Belegstellen. Das Wedeler Folgekostenkonzept ist dagegen eindeutig und öffentlich. Der Beitrag zeigt die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Regel.
Wenn Kritik selbst zum Thema wird
In der Facebookgruppe „Wedel-Germany“ hat sich eine bemerkenswerte Auseinandersetzung entwickelt: Rosemarie Binz-Vedder kritisiert meine Arbeit – nicht inhaltlich, sondern vor allem meine Rolle als Kritiker und den Ort, an dem ich antworte. In meinem aktuellen Beitrag analysiere ich ihre Beiträge, ordne ihre Vorwürfe ein und zeige, was dieses Beispiel über den Umgang mit Widerspruch in unserer lokalen Online-Debatte verrät.
Meinungsfreiheit oder Meinungsverbot? – Eine Einordnung der Vorwürfe von Rosemarie Binz-Vedder
Verträge gekündigt – Einrichtungen in Gefahr?
Ein dramatischer Zeitungs-Teaser, eine bekannte Facebookgruppe – und schon kocht die Empörung hoch. Dabei ist die Maßnahme seit Langem Teil der Haushaltssicherung 2028 und soll die Einrichtungen gar nicht schließen. Warum trotzdem viele kommentieren, ohne zu lesen – und was das über unsere Debattenkultur sagt, lesen Sie hier.
Ein Maibaum, zwei Tänzer – und viele kalte Worte
Was als heiterer Moment beim Maibaumfest begann, endete in einer Diskussion voller Spott und Zynismus: In der Facebookgruppe „Wedel-Germany“ zeigte sich erneut, wie schwierig ein respektvoller Austausch geworden ist. In meinem neuen Artikel geht es nicht nur um ein Fest, sondern um eine Frage, die uns alle betrifft: Wie wollen wir in dieser Stadt eigentlich miteinander umgehen?
Wut statt Argumente? Wie die Diskussion zur Infrastrukturabgabe entgleist
Die Infrastrukturabgabe ist ein legitimes Streitthema – doch in der Facebookgruppe „Wedel - Germany“ schlägt die Diskussion derzeit in Misstrauen, Unterstellungen und persönliche Angriffe um. Was das über die politische Kultur in unserer Stadt sagt, kommentiert ich in meinem aktuellen Beitrag:
Infrastrukturabgabe: Zwischen Fakten und Framing
Die Diskussion über die Infrastrukturfolgekostenabgabe wird aktuell auch in der Facebookgruppe „Wedel“ intensiv – und teilweise emotional – geführt. Zwei besonders pointierte Kommentare stammen von Karin Brand und Sven Kloevekorn.
Ich habe mir ihre Aussagen näher angesehen, sie den tatsächlichen politischen Beschlusslagen gegenübergestellt – und kommentiert, was daran sachlich richtig ist und was nicht.
Wie in Wedel Meinung gemacht wird – drei Fälle, drei Muster (April 2025)
In der öffentlichen Diskussion über die Wedeler Stadtpolitik treten immer wieder einzelne Stimmen auf, die sich regelmäßig und mit großer Vehemenz äußern – insbesondere auf Facebook. Ihre Beiträge sind oft zugespitzt, persönlich und von einem klaren Freund-Feind-Denken geprägt. Was sie eint: Sie stilisieren sich selbst als unabhängige Aufklärer und vermeintlich kritische Beobachter. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Es geht ihnen weniger um sachliche Auseinandersetzung als um Stimmungsmache.
Die Mittel sind dabei oft dieselben: verkürzte Darstellungen, gezielte Auslassungen, einseitige Empörung und das wiederholte Infragestellen demokratischer Prozesse oder einzelner Entscheidungsträger – ohne Belege, ohne Kontext, ohne Verantwortungsgefühl. Diese Art der Kommunikation erzeugt Misstrauen, zersetzt das Vertrauen in die politischen Institutionen der Stadt und vergiftet das Klima der öffentlichen Debatte.
Mir geht es mit diesen drei Artikeln nicht darum, einzelne Personen an den Pranger zu stellen. Vielmehr möchte ich sichtbar machen, wie sich ein bestimmtes Kommunikationsmuster in der lokalen Öffentlichkeit etabliert hat – eines, das letztlich gefährlich ist: Es ersetzt Auseinandersetzung durch Abwertung, Kritik durch persönliche Angriffe und Fakten durch Narrative. Wer so handelt, leistet keinen Beitrag zur Verbesserung politischer Entscheidungen – sondern erschwert sie.
Die folgenden drei Artikel analysieren exemplarisch, wie solche Meinungsäußerungen funktionieren, welche Rhetorik dahintersteht – und was sie über den Zustand der politischen Debatte in Wedel aussagen:
- Artikel 1: Zwischen berechtigter Kritik und pauschaler Delegitimierung
- Artikel 2: Respekt muss man sich verdienen – Wenn Moral zur Waffe wird
- Artikel 3: Wenn falsche Aussagen die Debatte bestimmen sollen
Ich weiß: Die Personen, um deren Beiträge es hier geht, werden ihr Verhalten vermutlich nicht ändern. Aber vielleicht können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die politische Diskussion in Wedel sich dennoch verändert. Nicht durch einen kritikfreien Raum – Kritik ist notwendig, lebendig und unverzichtbar. Aber durch eine Kultur, in der Kritik ehrlich, differenziert und respektvoll geäußert wird. In der man Fragen stellt, statt Unterstellungen zu machen. In der man bereit ist, zuzuhören – und selbst zu reflektieren.
Ich habe versucht, dafür einzutreten. Und ich bin, in vielerlei Hinsicht, gescheitert. Aber vielleicht gelingt es gemeinsam besser. Vielleicht lässt sich ein Gesprächsklima schaffen, das wieder mehr Vertrauen, mehr Verständnis und letztlich auch bessere Entscheidungen ermöglicht. Ich würde es mir wünschen. Und ich lade jede und jeden ein, daran mitzuwirken.
Über eine Facebook-Debatte, persönliche Kritik und die Frage, wie man in Wedel miteinander streiten sollte
Was mit einem kritischen Facebook-Post zur Innenstadt begann, entwickelte sich innerhalb weniger Tage zu einer aufgeladenen Debatte über Öffentlichkeit, Meinungsfreiheit und den Umgang mit Kritik.
Ich habe auf die Aussagen von Rosemarie Binz-Vedder öffentlich reagiert – und wurde daraufhin selbst zum Ziel persönlicher Angriffe, bis hin zur offenen Diffamierung durch Gernot Kaser.
Warum ich trotzdem bei meiner Haltung bleibe – und warum ich glaube, dass Wedel eine bessere Streitkultur verdient – lesen Sie in meinem neuen Beitrag:
Regeln allein reichen nicht.
Was eine Facebook-Gruppe wie „Wedel – Germany“ zur konstruktiven politischen Debatte beitragen könnte – und warum es dafür mehr braucht als ein paar Zeilen Hausordnung. Eine Schlussbemerkung über Verantwortung, Kultur und digitale Öffentlichkeit in Wedel.
In vielen Diskussionen der Facebook-Gruppe „Wedel – Germany“ tritt Rosemarie Binz-Vedder als Verfechterin von Transparenz und Bürgerbeteiligung auf. Ihre Forderungen wirken auf den ersten Blick berechtigt – etwa wenn sie schreibt:
„Bürger wünschen sich Transparenz und Antworten, um Entscheidungen nachvollziehen zu können.“
Doch wer genauer hinsieht, erkennt eine bedenkliche Schieflage: Kritik an der eigenen Person oder an politischen Verbündeten wird reflexartig abgewehrt – nicht mit Argumenten, sondern mit Unterstellungen und Dominanzgesten. So erklärte sie in einem Kommentar wörtlich:
„Hier lasse ich das nicht zu.“
Und weiter:
„Ich finde, Sie haben nicht das Recht, User:innen […] öffentlich anzugreifen. Genau deshalb hatte ich Sie zeitweise geblockt.“
Wer so spricht, will keine Diskussion – sondern Kontrolle über das, was gesagt werden darf. Dabei stellt sich die Frage: Wer darf eigentlich noch widersprechen, wenn Widerspruch sofort als „Stimmung machen“ oder „Hetze“ gewertet wird?
Wer Transparenz fordert, muss auch mit Widerspruch umgehen können – und sollte ihn nicht moralisch delegitimieren. Auch wohlmeinende Forderungen nach Aufklärung werden zum Monolog, wenn der Dialog nur in eine Richtung laufen darf.
Was bleibt von einer Diskussion, wenn man Kritik nicht aushält?
Hinweis: Diese Fußnote bezieht sich auf die Diskussion vom 17. April 2025 in der Facebook-Gruppe „Wedel – Germany“. Der vollständige Verlauf ist hier einsehbar.

Zwischen Schwarzmalerei und Realität: Wie sicher ist Wedels Innenstadt?
Immer wieder machen in den sozialen Netzwerken Beiträge die Runde, die ein dramatisches Bild der Wedeler Innenstadt zeichnen: Leerstand, Kriminalität, Verfall. Besonders ein Facebook-Post hat zuletzt für Aufsehen gesorgt – mit drastischen Formulierungen, einer Mischung aus Empörung und Angst und einer Reihe von Beispielen, die suggerieren: Hier läuft alles aus dem Ruder.
Doch stimmt dieses Bild wirklich?
In meinem aktuellen Kommentar hinterfrage ich die Aussagen dieses Beitrags – aus der Perspektive eines Menschen, der fast zwei Jahrzehnte lang selbst in der Bahnhofstraße gelebt, gearbeitet und mitgestaltet hat.
Ich zeige: Ja, Wedels Innenstadt hat Probleme. Aber sie ist weit mehr als nur ein Ort der Kriminalität oder des Niedergangs. Es geht um Perspektiven, um konkrete Herausforderungen – aber auch um Wertschätzung für das, was da ist.
👉 Hier geht’s zum Artikel: Wedel hat Herausforderungen. Aber Wedel ist nicht verloren.
Polarisierung, Desinformation und digitale Konflikte: Die Debatte um „Lea Amann“ (Januar 2025)
In den Wedeler Facebook-Gruppen tobt eine Debatte, die weit über einfache Meinungsverschiedenheiten hinausgeht. Im Zentrum: ein mysteriöser Account namens „Lea Amann“, der seit Ende 2024 immer wieder mit scheinbar gut recherchierten, aber stark polarisierenden Beiträgen auffällt.
Was zunächst wie ein weiteres Mitglied der digitalen Community wirken mag, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als gezielt agierender Akteur mit klarer Agenda. Unterstützt wird eine rückwärtsgewandte politische Erzählung, Desinformation wird gestreut, alte Konflikte neu aufgewärmt – stets unter dem Deckmantel der Neutralität.
In dieser zweiteiligen Artikelserie analysiere ich, welche Strategien hinter den Beiträgen von „Lea Amann“ stehen, warum die Debatte symptomatisch für eine problematische Kommunikationskultur in Wedel ist – und wie wichtig es ist, wieder zu einer sachlichen Auseinandersetzung zurückzukehren.
👉 Hier geht’s zu den Artikeln:
Sparkassen-Serie: Was hinter der Debatte wirklich steckt (Januar 2025)
In Wedel wird kontrovers über die Rolle und das Finanzgebaren der Stadtsparkasse diskutiert – vor allem in sozialen Medien. Immer wieder stehen AT1-Anleihen, Gewinnabführungen und das Verhältnis zwischen Stadt und Sparkasse im Fokus. Besonders lautstark äußert sich dabei Herr Kaser, der mit teils scharfer Kritik und weitreichenden Vorwürfen für Aufmerksamkeit sorgt.
Doch wie stichhaltig sind seine Aussagen wirklich? Welche rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Grundlagen gelten? Und wie transparent agiert die Sparkasse tatsächlich?
In einer Serie aus vier Artikeln habe ich die zentralen Kritikpunkte aufgegriffen, analysiert und gegenübergestellt – faktenbasiert, differenziert und mit dem Ziel, mehr Klarheit in eine emotional aufgeladene Debatte zu bringen.
Ich lade Sie ein, sich selbst ein Bild zu machen. Jeder Beitrag dieser Reihe beleuchtet einen anderen Aspekt der Diskussion – von der AT1-Anleihe über die Gewinnverwendung bis hin zu grundsätzlichen Fragen der kommunalen Verantwortung.
👉 Hier geht’s zu den Artikeln:
-
Fakten statt Polemik – Warum die Kritik von Herrn Kaser an der AT1-Anleihe nicht überzeugt
-
Sparkassenrecht und Gemeinnützigkeit – Analyse der Kritik an der Stadtsparkasse Wedel
-
Zahlen, Annahmen, Wirklichkeit – Kritische Analyse: Herr Kasers Aussagen zur AT1-Anleihe
-
Transparenz oder Populismus? – Analyse: Gewinnabführungen und Kritik von Herrn Kaser